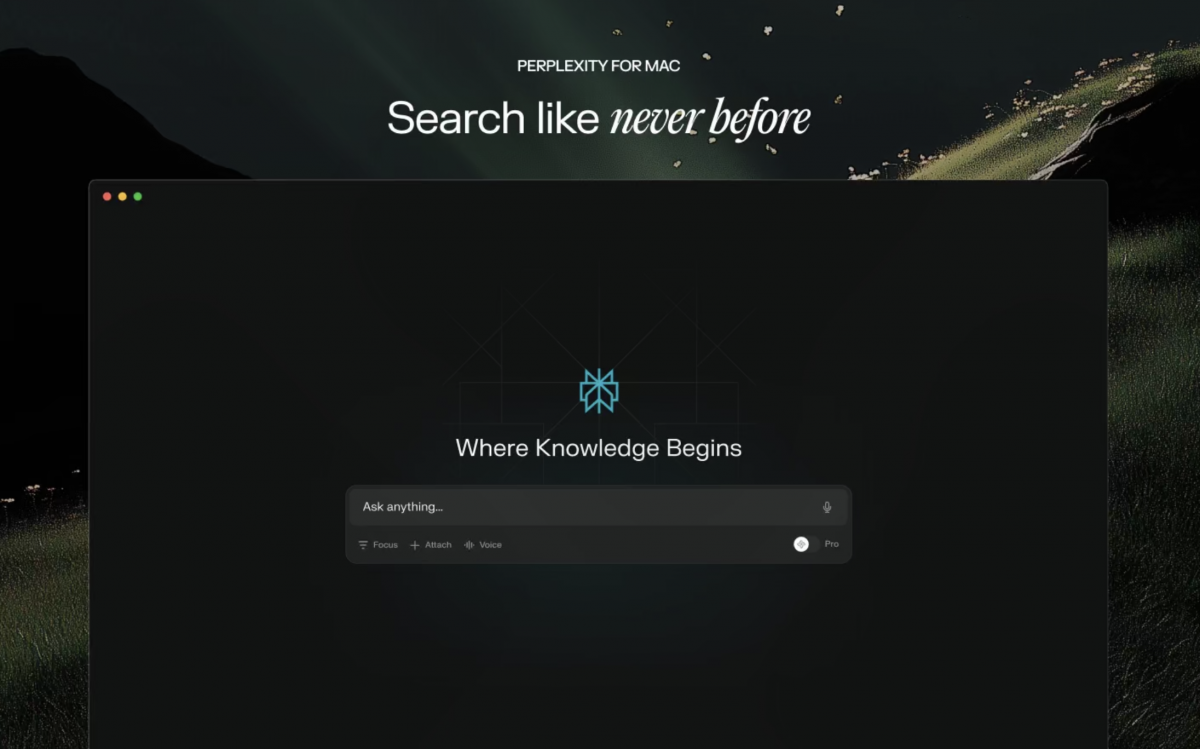Ein Hamburger Unternehmer will das Spitalwesen revolutionieren: mit Lazarettschiffen und aus Containern zusammengesetzten Kliniken Weltweit fehlt es an medizinischer Infrastruktur. Eine Firma mit Sitz in der Schweiz bringt nun Module auf den Markt, die leicht transportiert und aufgebaut, aber auch jederzeit ergänzt oder wieder abgebaut werden können.
Weltweit fehlt es an medizinischer Infrastruktur. Eine Firma mit Sitz in der Schweiz bringt nun Module auf den Markt, die leicht transportiert und aufgebaut, aber auch jederzeit ergänzt oder wieder abgebaut werden können.

In Kriegsgebieten wie im Sudan oder im Gazastreifen fehlt es an Spitalbetten und sterilen Operationssälen. Aber auch nach Umweltkatastrophen wie dem Erdbeben in der Türkei oder den Überschwemmungen in Libyen mangelt es an professioneller medizinischer Hilfe für die Opfer.
Der Hamburger Unternehmer Ulrich Marseille will dieses Vakuum füllen. Mit Spitalschiffen und mit Krankenhäusern aus modularen Containersystemen, die schnell und unkompliziert überall auf der Welt zusammengebaut werden können.
Das von ihm gegründete Unternehmen Worldwide Hospitals hat sieben Containerschiffe gekauft, die zu hochmodernen Spitälern umgebaut werden. Zwei der Schiffe verlassen demnächst die Werft in China und sind ab Anfang 2024 einsetzbar.
Die Lazarettschiffe sind sieben Stockwerke hoch und bieten rund tausend Quadratmeter Platz für medizinische Nutzung. So könnten über hundert stationäre Patienten, drei Operationssäle und 32 Räume für ambulante Untersuchungen in einer solchen mobilen Klinik untergebracht werden. Je nach Einsatzgebiet werden die Schiffe aber mit unterschiedlichen Modulen bestückt.
Erster Einsatz in Sierra Leone
Das erste Lazarettschiff wird im Januar Sierra Leone ansteuern, wo mindestens acht Wochen lang Frauen mit Geburtsfisteln operiert werden sollen. Die Besatzung des zweiten Schiffs ist auf kardiologische Probleme spezialisiert. Es wird sechs Wochen in Kamerun eingesetzt.
Diese zwei Einsätze in Afrika sind kostenlose Werbeaktionen. Anders als Mercy Ships, eine amerikanische NGO, die sich seit Jahren in Afrika engagiert, ist Marseilles Unternehmen jedoch kein Wohltätigkeitsprojekt, es soll wirtschaftlich rentabel sein. Der 67-Jährige träumt davon, mit seinen Containern das Gesundheitswesen weltweit zu revolutionieren.
«Das Wachstumspotenzial ist riesig», sagt er im Gespräch mit der NZZ. Der Gesundheitssektor befinde sich weltweit in einer Krise. Nicht nur in den ärmsten Weltgegenden mangle es an Kliniken, auch in vielen Schwellenländern könne der Gesundheitssektor nicht mit dem rasanten Bevölkerungswachstum mithalten. Selbst in Industrieländern wie Deutschland ist die Spitalinfrastruktur laut Marseille vielerorts veraltet, viele Kliniken müssen ausgebaut und modernisiert werden. Doch der Bau neuer Krankenhäuser dauert Jahre.
Laut Schätzungen der WHO hat über die Hälfte der Weltbevölkerung keinen Zugang zu Spitälern mit chirurgischer Versorgung.
Ulrich Marseille kennt sich im Geschäft mit der Gesundheit aus. Er ist seit den 1980er Jahren in dem Sektor tätig. Er hatte in Deutschland einst ein Imperium von Pflegeheimen und Kliniken, die Marseille-Kliniken. Seine MK Group war aber auch im Ausland aktiv.
2017 hat sich Marseille aus dem Betrieb von Pflegeheimen und Klinken in Deutschland zurückgezogen. Der Verkauf der Betriebe brachte damals rund 270 Millionen Euro ein. Die dazugehörigen Immobilien wurden 2019 für über 250 Millionen verkauft.
Investitionen in Höhe von 300 Millionen
Nun hat Marseille 300 Millionen Euro in Worldwide Hospitals investiert. Die Firma beschäftigt tausend Personen und hat ihren Hauptsitz in der Schweiz. Die ersten zwei Fabriken zur Produktion von Spitalmodulen befinden sich in Serbien und Spanien. An den beiden Standorten können pro Jahr 14 mittelgrosse Krankenhäuser produziert werden. Der Bedarf ist laut Marseille aber sehr viel grösser, und das Wachstumspotenzial enorm. «Wenn die Nachfrage steigt, können wir weitere Fabriken eröffnen, und zwar direkt in jenen Regionen, in denen Spitäler gebraucht werden.»
Bereits Ende nächsten Jahres soll Worldwide Hospitals schwarze Zahlen schreiben. Bis 2025 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von 2,3 Milliarden Dollar.
«Es ist erstaunlich, dass noch niemand vor uns auf diese Idee gekommen ist», sagt Marseille im Gespräch. Derzeit fliegt er um die Welt, um Werbung für sein Projekt zu machen. Die Gespräche mit Regierungschefs, Vertretern der Uno und anderen internationalen Organisationen seien vielversprechend, sagt er. Das Interesse an den Fertigbauspitälern sei gross. Der Unternehmer geht davon aus, dass bereits im kommenden Jahr die ersten vorfabrizierten Krankenhäuser in Betrieb genommen werden.
Die modularen Systeme sind schnell einsetzbar, weil vorfabriziert und einfach zu transportieren und aufzubauen. Sie können auch leichter modifiziert und erweitert werden. Werden mehr Bettenstationen gebraucht, fügt man ein paar entsprechende Module an, braucht man weniger OP-Räume und mehr Labore, tauscht man die Module aus.
Das Modulsystem eignet sich sowohl für Nothilfe wie auch für die langfristige Nutzung. Es können Spitäler in beliebiger Grösse und Spezialisierung zusammengesetzt werden, fast so unkompliziert, wie man bei Ikea eine Küche auswählt. Der Kunde bestimmt, wie viele Untersuchungsräume, stationäre Patientenzimmer, sterile OP-Räume, Labore, Apotheken oder Röntgen-, Ultraschall- und CT-Stationen er braucht.
Neben der Infrastruktur will Worldwide Hospitals bei Bedarf auch Ärztinnen und Pfleger sowie Personal für Unterhalt, Management und IT-Support zur Verfügung stellen. Geplant ist die Zusammenarbeit mit einem australischen Medizindienstleistungsanbieter. Das Ziel sei aber nicht, die Spitäler längerfristig zu betreiben, sagt Marseille. «Wir wollen durch Ausbildung und Mentoring vielmehr dazu beitragen, dass die Krankenhäuser nach ein paar Jahren mit lokalem Personal geführt werden können.»
Andrea Spalinger, «Neue Zürcher Zeitung»