EU-Verträge: Neue Regeln aus Brüssel gelten direkt in der Schweiz Der Bundesrat folgt bei der dynamischen Rechtsübernahme weitgehend der Forderung der EU: Wenn Brüssel neue Akte erlässt, werden diese eins zu eins Teil der Schweizer Rechtsordnung.
Der Bundesrat folgt bei der dynamischen Rechtsübernahme weitgehend der Forderung der EU: Wenn Brüssel neue Akte erlässt, werden diese eins zu eins Teil der Schweizer Rechtsordnung.
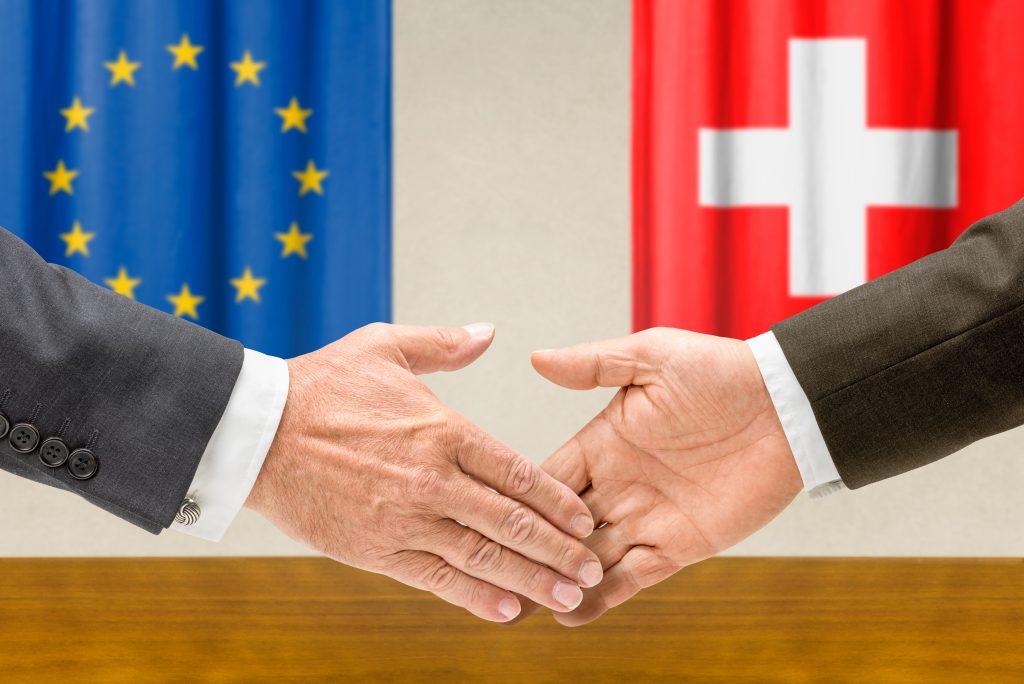
«Wir können immer Nein sagen» – das ist eines der wichtigsten Argumente, mit denen die Pro-Seite für die neuen Verträge mit der EU wirbt. Mit «Wir können immer Nein sagen» wollen die Befürworter die Angst vor der dynamischen Rechtsübernahme nehmen. Dynamische Rechtsübernahme heisst: Die Schweiz verpflichtet sich, bei den bisherigen und den neuen Binnenmarktabkommen künftige EU-Vorschriften laufend zu übernehmen.
Die Kritiker halten nicht viel von dieser Zusicherung. Sie sehen die direkte Demokratie in Gefahr. «Wenn die EU neue Regeln einführt, gelten sie, ohne dass das Parlament und das Volk darüber abstimmen können!», behauptete die SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo jüngst im Streitgespräch mit dem SP-Nationalrat Eric Nussbaumer bei «20 Minuten». Dieser konterte: «Wir können über sämtliches EU-Recht, das wir je übernehmen wollen, in unseren eigenen demokratischen Prozessen entscheiden.» Und weiter: «Nach wie vor gilt der Gesetzgebungsweg über Volk, Parlament oder Bundesrat.»
Keine landesrechtliche Umsetzung
Was stimmt? Bleibt alles beim Alten, wie Nussbaumer sagt? Oder werden Parlament und Volk übergangen, wie Martullo es darstellt? Wer eine Antwort darauf sucht, muss wissen, wie die Übernahme des neuen EU-Rechts abläuft. Es gibt zwei Methoden: das Äquivalenzverfahren und das Integrationsverfahren. Für die Abkommen über Landverkehr und technische Handelshemmnisse (MRA) gilt Äquivalenz, für die anderen Verträge – Freizügigkeit, Strom, Lebensmittel, Luftverkehr – Integration.
Die Schweiz hat sich hier weitgehend dem Willen der EU gefügt. Die Methode – Äquivalenz oder Integration – war während der Verhandlungen über die Verträge umstritten. Die EU habe bei allen Verträgen die Integrationsmethode durchsetzen wollen, schreibt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Anfrage. Das EDA wertet es als «Verhandlungserfolg der Schweiz, dass die Äquivalenzmethode im Landverkehrsabkommen und im MRA beibehalten» werden konnte. Man kann es auch anders sehen: Die Integration wird die dominierende Methode für die Rechtsübernahme. Sie gilt nicht nur für die Mehrheit der Verträge, sie gilt vor allem für die politisch heikelsten Verträge, bei denen Rechtsentwicklungen besonders umstritten sein dürften.
Dabei geht es nicht bloss um eine rechtstechnische Frage. Zwischen Äquivalenz und Integration besteht ein wesentlicher Unterschied: Im ersten Fall sind die neuen EU-Rechtsakte nicht direkt anwendbar. Die Schweiz muss dafür sorgen – mit einer Verordnung oder einem Gesetz –, dass ihr Recht jenem der EU entspricht. Wie sie das tut, ist ihr überlassen. Am Ende muss eine gleichwertige Regelung vorliegen, diese muss aber nicht mit jener der EU identisch sein. Die Äquivalenzmethode lässt der Schweiz also einen gewissen Spielraum.
Die Integrationsmethode tut das nicht: Die in Brüssel beschlossenen Rechtsakte werden unmittelbar Teil des Schweizer Rechts. «Diese Rechtsakte werden von der Schweiz grundsätzlich direkt angewendet, ohne dass sie in das Landesrecht überführt werden müssen», schreibt der Bundesrat in seinen Erläuterungen.
Von Sportpferden bis zu Marktständen
Um das Ganze konkreter zu machen: Das geplante Lebensmittelabkommen umfasst 61 Rechtsakte der EU. Zu diesen Rechtsakten kommen zusätzlich die darauf gestützten Erlasse der EU-Kommission. Alle diese Regelungen gelten neu für die Schweiz, und sie muss auch alle künftigen Änderungen übernehmen. Dabei geht es um sehr unterschiedliche Dinge, um Saatgut, Pestizide, Sportpferde, Zuchtschweine, um den Transport von Haustieren, um Vitamine und Mineralstoffe und vieles mehr. Und es geht um Lebensmittelhygiene. Unter anderem schreibt die EU vor, welche Bedingungen in Verkaufslokalen bis hin zu Marktständen einzuhalten sind, es gibt Vorschriften über Umkleidekabinen für das Verkaufspersonal, Zertifizierungen von Küchen, Hygieneschulungen für Verkäuferinnen und anderes mehr.
Wenn für das Lebensmittelabkommen die Äquivalenzmethode gelten würde, hätte es die Schweiz in der Hand, eigene Regeln über die Lebensmittelhygiene an Marktständen zu erlassen, die eventuell lebensnäher und unbürokratischer wären als jene aus Brüssel. Mit der Integrationsmethode hat sie diese Möglichkeit nicht. Das heisst: Die Schweiz wird dasselbe Regelwerk haben wie die EU.
Was im Kleinen für den Verkauf an Marktständen gilt, gilt im Grossen für den gesamten Lebensmittelbereich, für die Personenfreizügigkeit oder für den Strom: Wenn die EU Änderungen beschliesst, dann gelten diese hierzulande grundsätzlich direkt. Die Integrationsmethode ist ein weitgehender staatspolitischer Schritt für die Schweiz. Dass fast die gesamte Rechtsübernahme nach diesem Modell funktioniert und die EU-Regeln direkt Teil der Schweizer Rechtsordnung werden, ohne landesrechtliche Umsetzung, wurde bisher nicht thematisiert. Der Bundesrat ist in dieser Hinsicht sehr zurückhaltend: Im 931 Seiten dicken Vernehmlassungsbericht wird die Integrationsmethode diskret unter Ziffer 2.1.5.2.2 abgehandelt.
Der Gemischte Ausschuss als Schlüsselstelle
Die Integration der neuen Akte aus Brüssel läuft wie folgt ab: Erlässt die EU eine neue Vorschrift, informiert sie den Gemischten Ausschuss (GA) darüber, dass die Schweiz diese integrieren muss. Für jedes Abkommen gibt es einen Gemischten Ausschuss, dieser besteht aus Beamten und Diplomaten der Schweiz und aus solchen der EU. Der GA muss die Integration «so rasch als möglich» beschliessen; so steht es in den Verträgen. Dieser Beschluss des GA ist für die Schweiz bindend: Ab diesem Moment hat sie das EU-Recht übernommen, es tritt sofort in Kraft. Sagen die Diplomaten und Beamten im Gemischten Ausschuss Ja, sagt die Schweiz Ja.
Eine Ausnahme gilt, wenn die Schweiz «verfassungsrechtliche Verpflichtungen» erfüllen muss. Dann muss der GA dies der EU-Seite mitteilen. «Erfordert der Beschluss (. . .) die Erfüllung verfassungsrechtlicher Verpflichtungen seitens der Schweiz, um Rechtswirksamkeit zu erlangen, so verfügt die Schweiz (. . .) über eine Frist von höchstens zwei Jahren, wobei sich die Frist im Falle eines Referendums um ein Jahr verlängert», heisst es in den Verträgen. Die Schweiz hat also maximal drei Jahre Zeit, das neue Recht einzuführen. Sonst drohen Ausgleichsmassnahmen.
Was «verfassungsrechtliche Verpflichtungen» genau sind, dazu äussert sich der Bundesrat in seinen Erläuterungen kaum. Man kann wohl davon ausgehen, dass die Schweizer Beamten, die im Gemischten Ausschuss sitzen, neues EU-Recht nicht übernehmen dürfen, wenn es in einem offenen Widerspruch zu einem Bundesgesetz steht. Der Bundesrat müsste dem Parlament in einem solchen Fall wohl eine Botschaft unterbreiten, um das entgegenstehende Gesetz an das EU-Recht anzupassen.
Offen ist dagegen, wie mit Rechtsakten umgegangen werden soll, die nicht unbedingt eine Gesetzesanpassung erfordern, aber gleichwohl von einiger Tragweite sind. Oder mit Neuerungen, die innenpolitisch umstritten sind. Wenn die EU beispielsweise die Unionsbürgerrichtlinie ändert und den Familiennachzug auf weitere Verwandte ausweitet, muss das hiesige Ausländer- und Integrationsgesetz nicht unbedingt revidiert werden. Die Änderung wäre aber politisch bedeutsam. Wer würde entscheiden, ob das Parlament in einem solchen Fall mitreden kann?
Informationsreisen nach Brüssel
Zuständig für die Festlegung der Schweizer Position «sind die für den Fachbereich des betreffenden Abkommens verantwortlichen Departemente und das EDA», schreibt der Bundesrat in den Erläuterungen. Das Bundesamt für Justiz soll rechtliche Begleitung leisten. Es sind also der Aussenminister und die Bundesangestellten aus den federführenden Ämtern, die entscheiden, ob das Parlament und das Volk bei der Übernahme von EU-Recht einbezogen werden oder nicht.
Dieser Punkt dürfte im Parlament noch zu reden geben. Gerade in der letzten Zeit kam es bei aussenpolitischen Dossiers mehrmals zu Friktionen. Der Bundesrat sah sich als allein zuständig an, worauf das Parlament die eigene Mitbestimmung erzwingen musste – so etwa beim Uno-Migrationspakt oder beim WHO-Pandemievertrag. Die Frage, wann das Parlament mitreden dürfen soll, wird sich aller Voraussicht nach ebenso bei der EU-Rechtsübernahme stellen.
Klar ist: Damit das Parlament seine Mitsprache rechtzeitig einfordern kann, auch gegen den Willen des Bundesrats, müssen die Ratsmitglieder früh genug wissen, was sich in Brüssel tut und was auf die Schweiz zukommt. Wenn der Gemischte Ausschuss einen Rechtsakt erst einmal durchgewinkt hat, ist es zu spät. Der Bundesrat schlägt vor, dass das Parlament zu diesem Zweck einen eigenen Mitarbeiter nach Brüssel entsendet oder dass die Aussenpolitischen Kommissionen häufiger Informationsreisen in die EU durchführen. Das ändert aber nichts daran, dass die Räte massgeblich auf die Regierung und die Verwaltung angewiesen sein werden, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Schengen/Dublin als Vorbild
Der Bundesrat ist bemüht, die staatspolitische Tragweite der Rechtsübernahme zu relativieren. Er betont, dass die Schweiz künftig die Ausarbeitung von EU-Rechtsakten, die sie betreffen, mitgestalten könne (decision shaping). Auf diese Weise erfahre man frühzeitig, ob «heikle rechtsetzende Regelungen» zu erwarten seien. Auch weist er darauf hin, dass die dynamische Rechtsübernahme bei Schengen/Dublin problemlos funktioniere.
Möglicherweise machen sich die Kritiker tatsächlich zu viele Sorgen und wird die integrative Rechtsübernahme ohne Probleme ablaufen. Am Ende ist mitentscheidend, wie viel Vertrauen man in den Bundesrat, in die Diplomaten und in die Verwaltung hat. Vertrauen, dass sie wachsam sind, rechtzeitig handeln und Konflikte mit der EU-Seite nicht scheuen. Und dass sie die «verfassungsrechtlichen Verpflichtungen», die einen Einbezug des Parlaments und des Volks erfordern, nicht eng auslegen.






