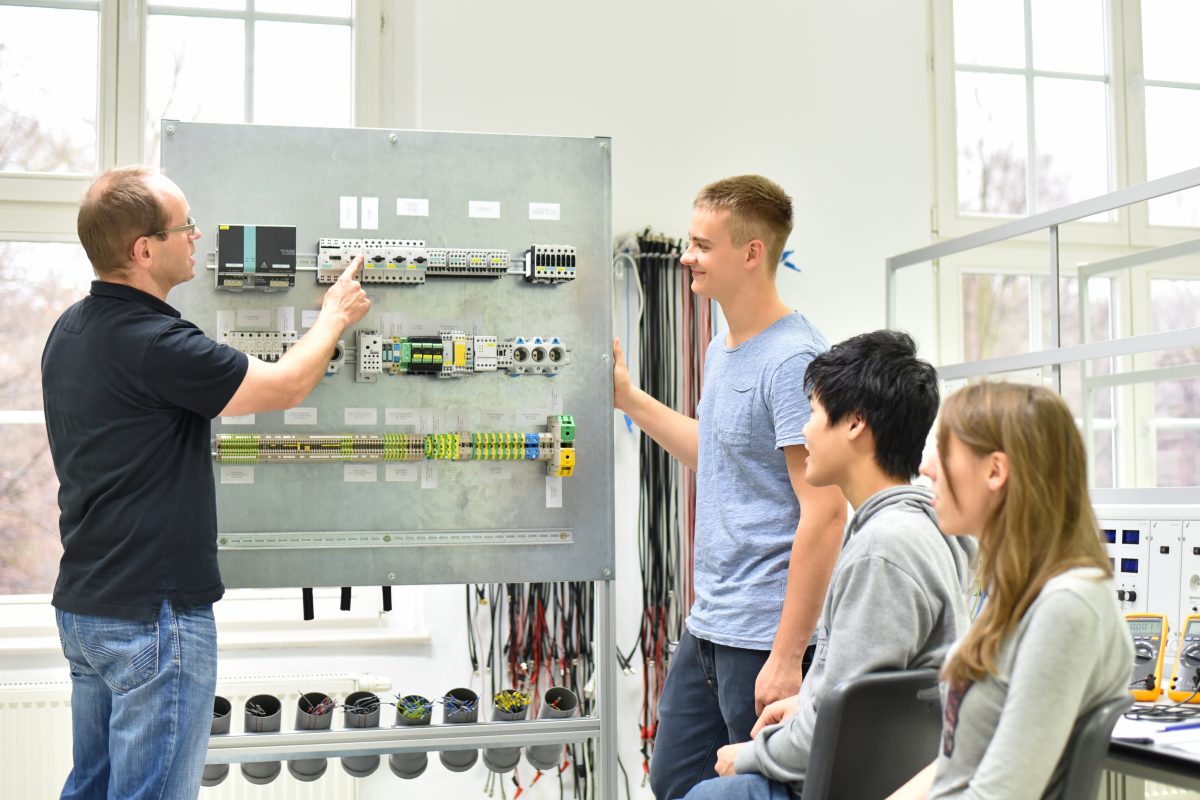Höhere Löhne sind zusehends ein individuelles Glück – denn automatische Teuerungsausgleiche gibt es kaum noch Die automatische Anpassung des Lohnes an die Teuerung war bei Schweizer Betrieben einst gang und gäbe. Heute kennt man solche Indexierungen kaum noch. Ironischerweise waren es nicht zuletzt auch die Gewerkschaften, die zum Niedergang des Instruments beitrugen.
Die automatische Anpassung des Lohnes an die Teuerung war bei Schweizer Betrieben einst gang und gäbe. Heute kennt man solche Indexierungen kaum noch. Ironischerweise waren es nicht zuletzt auch die Gewerkschaften, die zum Niedergang des Instruments beitrugen.

«Es wird ein Lohnherbst wie jeder andere.» Mit dieser Ansage hat der Schweizerische Arbeitgeberverband im Sommer seine Position für die Lohnverhandlungen abgesteckt. Es dürfte ein frommer Wunsch sein. Denn ein Jahr wie jedes andere ist 2022 mitnichten. Die Inflation ist mit 3,5 Prozent auch in der Schweiz aussergewöhnlich hoch. Entsprechend gross ist für Arbeitnehmer die Gefahr realer Einkommensverluste. Denn wenn der Lohn nicht mit der Teuerung mithält, bleibt Ende Monat bei gleichbleibendem Konsum weniger im Geldbeutel übrig.
Aus den Gesamtarbeitsverträgen verschwunden
Der Lohnherbst wird daher aussergewöhnlich sein. Und ringen dürfte man vor allem um den Teuerungsausgleich. Den Arbeitnehmern kommt dabei entgegen, dass die Arbeitslosenquote mit 2 Prozent so niedrig ist wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Zudem liegt die Zahl offener Stellen auf rekordhohem Niveau. Die Unternehmen haben somit Mühe, genügend Personal zu rekrutieren, und zwar in fast allen Branchen, wie Zahlen der Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) zeigen. All dies stärkt die Verhandlungsposition der Angestellten.
Mit dem Comeback der Inflation kehrt nun ein Thema zurück ins öffentliche Bewusstsein, das während Jahren kaum noch für Diskussionsstoff gesorgt hat: der automatische Teuerungsausgleich, also die vertragliche Anbindung des Lohnes an die Preisentwicklung. Eine solche Indexierung sorgt dafür, dass der Lohn real – also preisbereinigt – unverändert bleibt. Wenn die Inflation um 3 Prozent steigt, dann steigt automatisch auch der Nominallohn um diesen Prozentwert.
In der privatwirtschaftlichen Praxis spielen solche Klauseln kaum noch eine Rolle. Das war nicht immer so. In früheren Gesamtarbeitsverträgen (GAV) fanden sich viele derartige Automatismen. Wie eine Studie von Daniel Oesch (Universität Lausanne) aus dem Jahr 2001 zeigt, etablierten sich Teuerungsausgleiche vor allem ab den 1950er Jahren, und zwar bis in die frühen 1990er Jahre. Während 1957 etwa 17 Prozent aller GAV eine Teuerungsklausel enthielten, lag der Wert zu Beginn der 1980er Jahre bei 68 Prozent und verharrte dann rund zehn Jahre auf diesem Niveau.
In nur vier Jahren praktisch verschwunden
Von solchen Verträgen enthielt zu Beginn der 1990er Jahre zwar nur ein Viertel eine sogenannte Gleitlohnklausel, die dafür sorgte, dass der Nominallohn automatisch an die Konsumentenpreise angepasst wurde. Verbreiteter waren Verhandlungsklauseln, bei denen die Höhe des Ausgleichs ausgemarcht werden musste. Erstaunlich ist aber, wie rasch der automatische Teuerungsausgleich in Form von Gleitlohnklauseln an Bedeutung verlor. Profitierten noch 1992 rund 21 Prozent jener Arbeiter, die einem GAV unterstellt waren, von einer solchen Klausel, waren es 1996 nur noch verschwindend kleine 0,3 Prozent.
Vier Jahre reichten also, um den automatischen Teuerungsausgleich praktisch vollständig aus den GAV zu verdrängen. Seither hat sich der Trend nicht umgekehrt. Warum implodierte das System in den frühen 1990er Jahren so rasch? Vier Gründe stehen im Vordergrund: Erstens sank mit dem damaligen Rückgang der Inflation auch die Bedeutung eines Teuerungsausgleichs. Zweitens stürzte die Schweiz in jener Zeit in eine tiefe Rezession. Bei vielen Arbeitern wog daher die Angst um den Job schwerer als die Furcht, aufgrund der Teuerung einen Kaufkraftverlust beim Lohn zu erleiden.

Drittens gerieten die GAV im Zuge der Rezession der 1990er Jahre auch seitens der Arbeitgeberverbände zusehends unter Druck. So bezeichnete etwa der damalige Arbeitgeberpräsident Guido Richterich diese Verträge als ein Auslaufmodell. Und viertens zeigten sich in jenen Jahren einige Gewerkschaften etwa aus der chemischen Industrie überzeugt davon, dass jährliche Verhandlungen zum Teuerungsausgleich besser seien als fixe Klauseln – dies in der Hoffnung, so die Arbeiterschaft dauerhafter und stärker mobilisieren zu können.
Machtverlust der Gewerkschaften
Diese Rechnung ging nicht auf für die Gewerkschaften. Denn was in der Schweiz ab den 1990er Jahren einsetzte, war etwas anderes: Über Löhne und Teuerungszulagen wurde in immer mehr Branchen nur noch auf Betriebsebene verhandelt, nicht aber flächendeckend. Für die Arbeitnehmervertreter ging das mit einem Machtverlust einher. Zusammen mit der sich beschleunigenden Tertiarisierung (weniger Industrien, mehr Dienstleister) kam es zu einem Mitgliederschwund und einem Rückgang des Organisationsgrades bei den Gewerkschaften.
Gemäss Daniel Lampart, dem Chefökonomen des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB), existieren heute kaum noch GAV mit vollem automatischen Teuerungsausgleich. Einige Verträge sähen noch einen entsprechenden Automatismus zumindest für Mindestlöhne vor, etwa der GAV für die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. In anderen GAV wie im Buchhandel oder im Westschweizer Ausbaugewerbe würden die Löhne aber nur bis zu einer maximalen Inflation von 1 bis 2 Prozent automatisch angepasst; die darüber liegende Teuerung muss ausgehandelt werden.
Werden die Gewerkschaften das Thema der Lohnindexierung wieder aufs Tapet bringen? Lampart lässt die Frage offen, meint aber: «Wenn die Inflation auf hohem Niveau verharren sollte, würde die Forderung, den Teuerungsausgleich wieder in Gesamtarbeitsverträge zu integrieren, natürlich stark an Bedeutung gewinnen.» Priorität scheint die Sache aber nicht zu haben. Derzeit stünden die Lohnverhandlungen im Zentrum, nicht aber die grundsätzliche Erneuerung von GAV, sagt Lampart. Gefordert werden Lohnerhöhungen von 4 bis 5 Prozent, was über der erwarteten Jahresteuerung liegt.
Immer weniger generelle Lohnanpassungen
Naturgemäss drängen Gewerkschaften gegenüber Arbeitgebern auf generelle Lohnerhöhungen. Der allgemeine Trend – Lampart spricht von einer «Individualisierung der Lohnpolitik» – weist aber in die andere Richtung. Bei den wichtigsten GAV entfällt seit Jahren ein zusehends höherer Anteil der Lohnerhöhungen auf individuelle Anpassungen, während kollektive Zusicherungen abnehmen. Das war auch bei den Lohnabschlüssen für das vergangene Jahr der Fall, als von der nominalen Erhöhung um 0,4 Prozent im Schnitt rund 0,3 Prozent individuell und nur 0,1 Prozent kollektiv gewährt wurden.

«Lohnindexierungen sind in den vergangenen Jahren weitgehend vom Radar verschwunden», sagt Michael Siegenthaler, Arbeitsmarktökonom an der Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF). Das habe vielleicht auch damit zu tun, dass die Gewerkschaften in Zeiten von teilweise negativer Teuerung wenig Interesse an einem solchen Automatismus hätten. Denn die konsequente Umsetzung eines fixen Teuerungsausgleichs hätte ja bedeutet, dass bei sinkendem Preisniveau in gewissen Jahren ein Rückgang der Nominallöhne resultiert hätte. Bei den Angestellten wären solche Lohnkürzungen schlecht angekommen.
Weil niemand den Zorn der Belegschaft provozieren will, sind die Löhne nach unten in aller Regel sehr starr. Es ist selten, dass Unternehmen die Löhne ihrer Angestellten kürzen. Das war in der Schweiz auch im Jahr 2015 beim Franken-Schock der Fall. Die damalige Aufhebung des Euro-Mindestkurses stärkte zwar den Franken und führte dazu, dass die Kaufkraft der Löhne stieg. Die meisten Firmen nahmen 2015 aber eher ein Schmelzen der Margen oder Kapitalpolster hin, als dass sie die Löhne senkten, um sie in realer Betrachtung stabil zu halten.
Arbeitgeber fordern betriebliche Lösungen
Für Gewerkschaften sind automatische Anpassungen daher ein zweischneidiges Schwert, weil die Preise auch wieder sinken können. Beim Vorhandensein solcher Indexierungen und im Falle einer negativen Inflation fordert Lampart daher eine vertragliche Besitzstandsgarantie. Der Gewerkschafter betont, dass die Löhne nicht nur mit den Preisen, sondern auch mit der Produktivität mithalten müssten. «Und weil die Produktivität pro Jahr im Schnitt um rund 1 Prozent steigt, liesse sich auf diese Weise jeder Preisrückgang der vergangenen Jahre kompensieren.»
Die Arbeitgeber sehen das natürlich anders: «Würde es einen Automatismus zum Teuerungsausgleich geben, so würde dieser natürlich nicht nur im Falle einer positiven, sondern auch im Falle einer negativen Teuerung angepasst. Das kann kaum im Interesse der Gewerkschaften sein», sagt Simon Wey, der Chefökonom des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes. Er fügt an, dass die Teuerung in den letzten Jahren oftmals negativ gewesen sei und die Nominallöhne trotzdem gestiegen seien. Preisbereinigt gewannen die Einkommen in dieser Zeit somit an Kaufkraft.
Der Arbeitgebervertreter hält wenig von Automatismen, zumal diese den Gegebenheiten in den Firmen keine Rechnung trügen. «Eine hohe Teuerung heisst nicht zwangsläufig, dass auch der Spielraum für höhere Löhne besteht», sagt Wey. Zudem komme ein automatischer Teuerungsausgleich einer generellen Lohnerhöhung für alle gleich, unabhängig vom Einsatz des Einzelnen. «Es ist sozusagen eine Lohnerhöhung mit der Giesskanne.» Durch individuelle Erhöhungen hingegen könne man Anreize für überdurchschnittliche Leistungen setzen.
Notenbanken fürchten Indexierungen
Wenig Begeisterung an indexierten Löhnen haben auch die meisten Notenbanken der Industrieländer. Sie erinnern sich noch gut an die Stagflation der 1970er Jahre, als eine relativ hohe Zahl indexierter Löhne dazu beitrug, dass sich die Inflation verfestigte und vielerorts eine Lohn-Preis-Spirale in Gang gesetzt wurde. Eine ähnliche Dynamik wie damals möchte man dieses Mal verhindern. Denn wenn eine solche Spirale erst einmal zu drehen beginnt, verselbständigen sich auch die Erwartungen zur Inflationsentwicklung, was eine geordnete Rückkehr zu stabilen Preisen stark erschwert.
Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) als Forum der Zentralbanken formuliert daher die Warnung: «Automatische Lohnindexierungen und Teuerungsanpassungen machen Lohn-Preis-Spiralen wahrscheinlicher.» Diese Gefahr sei heute aus institutionellen Gründen aber geringer als in der Vergangenheit, fügt die BIZ an. Denn in den letzten Jahrzehnten sei die Korrelation zwischen Lohnwachstum und Inflation zurückgegangen und liege derzeit nahe historischen Tiefstständen. Tatsache sei aber auch, dass diese Wechselwirkung jüngst wieder zugenommen habe.
Es ist nicht zuletzt der schwächeren Verhandlungsmacht der Gewerkschaften zuzuschreiben, dass im Privatsektor immer weniger Beschäftigte einen Arbeitsvertrag haben, bei dem die Inflation eine formale Rolle spielt bei der Lohnfestsetzung. Im Euro-Raum ist die Quote von 24 Prozent im Jahr 2008 auf 16 Prozent im Jahr 2021 gesunken; der Anteil von Gleitlohnklauseln beträgt gar nur 3 Prozent. In den USA sank der Anteil von Lohnklauseln von 60 Prozent in den späten 1970er Jahren auf 20 Prozent gegen Mitte der 1990er Jahre – seither wird die Abdeckung solcher Klauseln nicht mehr statistisch erfasst.
Schweizer Kultur der Zurückhaltung
Eher die Ausnahme als die Regel sind Länder wie Belgien, Luxemburg, Malta und Zypern, wo Lohnindexierungen noch immer ein hohes Gewicht haben. In Belgien sind beispielsweise fast alle Arbeitgeber dazu verpflichtet, ihre Löhne den Preisen anzupassen. Grundlage liefert der Gesundheitsindex, der die Lebenshaltungskosten um die Ausgaben für Energie, Kraftstoffe und ungesunde Waren wie Tabak oder Alkohol bereinigt. Weil der Index jüngst nach oben geschossen ist, sind auch die belgischen Lohnkosten stark gestiegen, was nicht nur die Arbeitgeber, sondern auch die Notenbank beunruhigt.
Das belgische System – eingeführt in den 1920er Jahren – wird im Land zusehends als Hypothek empfunden. Es belastet die internationale Wettbewerbskraft, was langfristig auch die Arbeitsplätze gefährdet. In der Schweiz wäre ein solches Modell kaum mehrheitsfähig. So hat die Credit Suisse jüngst in einer Analyse gezeigt, dass die Beziehungen zwischen den Sozialpartnern von grosser Kompromissbereitschaft geprägt ist. Es herrsche, so die CS-Ökonomen, eine «langfristig verankerte und systematische Lohnzurückhaltung», was dazu beitrage, schwere Zeiten wie etwa Finanzkrisen, Rezessionen oder Pandemien besser zu überstehen.
«Automatische Teuerungsanpassungen sind inhaltlich am meisten gerechtfertigt, wenn die Firmen dank Inflation höhere Preise durchsetzen und ihre Erträge steigern können», sagt der KOF-Ökonom Siegenthaler. Derzeit komme die Inflation aber primär aus dem Ausland, und die importierte Teuerung habe bei vielen Unternehmen höhere Energiekosten und sinkende Margen zur Folge. «Einige Betriebe können es sich daher schlecht leisten, die Inflation voll auszugleichen.» Daher dürften es Forderungen nach kollektiven Lösungen, die alle Firmen über einen Kamm scheren, heute doppelt schwer haben. Eine baldige Rückkehr indexierter Löhne, die in der Hochinflationszeit der 1970er Jahre eine eher unrühmliche Rolle spielten, zeichnet sich nicht ab.