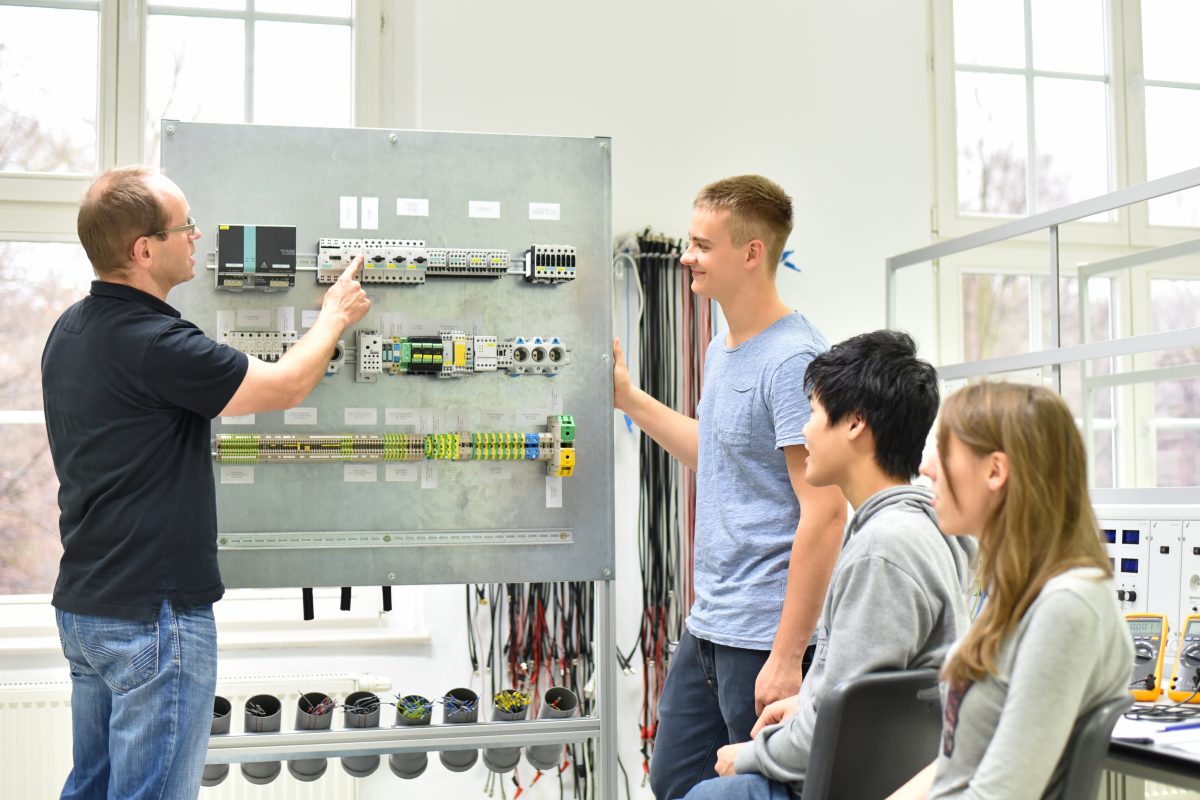«Wohin mit meinem Leben?» – Der bekannteste Türsteher von Zürich verliert seinen Job Die Stadtzürcher Klubs verschwinden. Innert zehn Jahren hat sich ihre Zahl fast halbiert.
Die Stadtzürcher Klubs verschwinden. Innert zehn Jahren hat sich ihre Zahl fast halbiert.

Franky hat Hunger und Hände wie Bratpfannen. Vor ihm steht ein Tisch, darauf eine Schale mit zehn geschälten Eiern. Der Türsteher braucht eine Tankfüllung für die Nacht. Er schnappt sich den Salzstreuer, verschlingt das Eiweiss und sagt: «Jetzt sind meine Batterien geladen.»
Es ist Samstagabend und kurz vor Mitternacht. Franky sitzt in einem Keller an der Langstrasse. Entlang der Betonwand verlaufen schwarze Linien und Graffiti. Überall stehen Kisten, gefüllt mit leeren Flaschen. Der Duft von abgestandenem Bier erfüllt die Luft.
Ein Stockwerk weiter oben dröhnt der Bass und zischt die Nebelmaschine. Frauen mit kurzen Röcken tanzen in rot-blauem Licht, während sich ihnen Männer mit hüpfenden Bewegungen nähern. Gin Tonic und Wodka Energy gehen über den Bartresen. In der Piranha-Bar an der Langstrasse wird gefeiert, so wie an vielen Orten in Zürich. Doch nicht mehr lange.
Ende März 2024 muss der Klub schliessen.
Franky gehört zum Inventar. Seit über zwanzig Jahren steht er beruflich vor der Tür des Lokals, das sich Bar nennt, aber eigentlich ein Klub ist. «Dass es bald vorbei ist, hätte ich nie gedacht», sagt der Türsteher und hält einen Moment inne.
In Frankys Oberarmen könnte eine Wassermelone versteckt sein. Beim Bankdrücken stemmt er 200 Kilo, wie er nicht ohne Stolz erzählt. Man glaubt es ihm gerne. Als Autorität aufzutreten, gehört zu seinem Jobprofil. Doch nun wirkt sein Blick unsicher, die Augen wässrig. Er schweigt, zieht die Nase hoch und sagt: «Bitte entschuldige, es zerreisst mir das Herz.»
Zürich, das einstige Party-Mekka
Das Aus der Piranha-Bar ist kein Einzelfall. In Zürich sterben die Klubs. Gab es 2011 noch 50 Diskotheken, waren es 2020 lediglich 31. Das zeigt eine Statistik der Stadt Zürich. Eine Trendumkehr ist nicht erkennbar, und ein genauer Blick auf die Zahlen macht deutlich, dass sich die Tanzlokale nicht verlagern, sondern verschwinden. Am stärksten trifft es den Kreis 4, den Arbeitsplatz von Franky. Dort schrumpfte die Zahl von 15 auf 8.
Dabei galt Zürich einst als Party-Mekka mit einer der höchsten Klubdichten Europas. Von überall her pilgerten die Leute in das Ausgehzentrum an der Limmat. In den 2000er Jahren konnte es Zürich mit Berlin, der Techno-Hochburg, aufnehmen. Mittlerweile gehört die Zürcher Techno-Kultur zu den lebendigen Unesco-Traditionen der Schweiz.
Doch nun wird die Szene Opfer des eigenen Erfolgs, so wie die Piranha-Bar.
Vor dem Tanzlokal liegt die Piazza Cella, das Herzstück der Langstrasse, der Partymeile Zürichs. Unter einem Vordach steht Franky und beobachtet das Geschehen. Auf den Bänken sitzen junge Leute. Sie rauchen, lachen und trinken direkt ab der Flasche.
Auf der anderen Strassenseite verkauft ein 24-Stunden-Shop Wodka in allen Regenbogenfarben. Nebenan flimmert das rote Neonlicht einer Reklametafel, über die Begriffe wie «Döner», «Pizza» und «Schnitzel-Brot» wandern. Im Quartier spricht man bereits von der «Fressmeile». Dabei waren es eigentlich die Klubs, die das Viertel prägten und revolutionierten.
Denn ursprünglich besass Zürich einen stieren und puritanischen Ruf. Bis kurz vor der Jahrtausendwende fehlte ein vielfältiges Nachtleben. In der «Zwinglistadt» wurden die Trottoirs um Mitternacht hochgeklappt. Lediglich vier Discos durften bis um 4 Uhr offen bleiben. In den 1980er Jahren forderte die Jugend mehr Freiraum, was sich in heftigen Demonstrationen entlud. Die Stadt reagierte. Mit der Roten Fabrik und dem Dynamo entstanden erste Kulturzentren für die junge Generation.
Zeitgleich formierte sich im Untergrund eine Technoszene. Sie verschaffte sich eigene Freiräume, tanzte in der Illegalität und verwandelte alte Industriegebäude, Lagerhallen, Keller, unfertige Neubauten oder Unterführungen in Paläste der Nacht.
1998 verschwand die Polizeistunde. Zugleich wurden die Hürden für den Ausschank von Alkohol gesenkt. Innert kürzester Zeit schoss die Zahl der Klubs von 4 auf 72 hoch. Der Erfolgsgeschichte des Zürcher Nachtlebens stand nichts mehr im Wege.
Eine Schlägerei als Bewerbung
Die wachsende Klubszene schaffte viele Arbeitsplätze, auch für Franky, der eigentlich Cheikh Diba heisst. Aufgewachsen in Dakar, der Hauptstadt Senegals, arbeitete der junge Mann als Schreiner. Da er das Vertrauen des Chefs genoss, durfte er immer wieder in die Schweiz reisen, um Ersatzteile für Maschinen zu besorgen. So lernte Diba eine Schweizerin kennen, verliebte sich und heiratete.
In Zürich machte er sich selbständig, als die Diskotheken das Nachtleben eroberten. 2002 benötigte die Piranha-Bar eine Bühne, und der Besitzer beauftragte Diba. Der Schreiner war gerade mit dem Aufbau beschäftigt, da begannen sich hinter ihm zwei Event-Organisatoren zu prügeln. Diba ging dazwischen und beruhigte die Situation. Es war die perfekte Bewerbung. Der Klubbesitzer Orhan Öztas bekam alles mit und holte Diba an Bord. In Zeiten des boomenden Nachtlebens war ein Auskommen als Türsteher lukrativer als sein Schreiner-Dasein.
Eine Schlägerei – und aus Diba wurde Franky, der Türsteher. Den Spitznamen hat ihm einst ein Klubbesucher gegeben. Es ist eine Anspielung auf «Frank the tank», einen fiktiven Charakter aus dem Spielfilm «Old School».
Ein Typ starrt minutenlang
In Zürich wurde das Feiern kommerzialisiert. Aus den illegalen Untergrundpartys entstand ein offizielles Geschäftsmodell, womit eine soziale Akzeptanz der Szene einherging. Wer mit Partys Geld verdiente, wurde nicht mehr länger geächtet. Im Gegenteil. Die Szene wertete das Langstrassenquartier auf. Das Rotlichtmilieu wandelte sich zu einem beliebten Ausgehviertel.
Das Geschäft mit der Nacht veränderte dessen Wahrnehmung. Franky bekommt das bis heute zu spüren. Wenn er vor der Tür steht, schauen andauernd Menschen vorbei. Frauen umarmen und küssen ihn auf die Wange. Männer klopfen ihm auf die Schulter, holen zum Handschlag aus und sagen: «Franky, mein Bruder, wie geht’s?» Manche erzählen von ihren Sorgen. Franky sagt: «Manchmal wird es mir zu viel.» Dann geht er in das Zimmer im Keller.
Mit dem Aufstieg der Klubs wurde Franky zum bekanntesten Türsteher in Zürich. In den Flitterwochen lag er mit seiner Frau am Strand von Kuba. Ein Typ stand 50 Meter abseits und starrte ihn minutenlang an, bis er näher kam. «Ich machte mich schon auf einen Konflikt gefasst», erzählt Franky. Da habe der Mann gesagt: «Swiss, Swiss, Zürich, Langstrasse, Piranha-Bar.»
Sogar die Polizei schätzt den Türsteher und hat sich bei ihm für seine Verdienste bedankt und ihm Souvenirs geschenkt, darunter ein Sackmesser. Erst kürzlich habe ein Polizist zu ihm gesagt: «Du hast mehr Taschendiebe gefasst als wir.» Und das ist nicht nur scherzhaft gemeint. Tatsächlich hielt Franky schon Dutzende von Gaunern fest, bis die Polizei eintraf. Auch einen Mann mit Sturmgewehr, der auf eine Frau zielte, soll er laut Eigenaussage entwaffnet haben, ohne dass jemand verletzt wurde.
Doch nicht immer kommt er glimpflich davon. Über seinem Hinterkopf und oberhalb beider Augenbrauen verlaufen drei Narben. Alle wegen Flaschen, die ihm jemand über den Schädel gezogen hat. Auch seine Nase zeugt von einer Gewalttat. Ein Mann wollte ihm mit einer Schere die Augen ausstechen, rutschte ab und schnitt Franky in die Nase. Eine V-förmige Narbe erinnert daran. Aber trotz den Zwischenfällen trägt Franky nie eine Schutzweste. Er sagt: «Grundsätzlich vertraue ich den Menschen.»
Die meisten Partygänger begegnen dem 125-Kilo-Mann mit grossem Respekt. Doch nun droht er nicht nur seinen Job, sondern auch seinen Status zu verlieren. Franky sagt: «Drei Dinge machen mein Leben aus: meine Familie, das ‹Fitness› und die Arbeit als Türsteher.»
Auf die Piranha-Bar soll ein Coop Pronto folgen
Das Gesicht der Langstrasse hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Dort, wo heute die Piranha-Bar ist, soll ein Coop Pronto entstehen und darüber Wohnungen, unter anderem für Familien. So erzählen es die Leute im Quartier, so sagen es Orhan Öztas von der Piranha-Bar sowie Alex Dallas. Letzterer ist Co-Gründer des Klubs Zukunft, der sich in derselben Liegenschaft wie die Piranha-Bar befindet. Nach fast zwanzig Jahren schliesst auch die «Zukunft» im kommenden Jahr ihre Tore.
Die Immobilienfirma Kornhaus habe den Klubbetreibern mitgeteilt, dass sie sich etwas anderes wünsche, ohne konkrete Gründe zu nennen.
Die Kornhaus-Verwaltung wollte sich gegenüber der NZZ nicht zu den Plänen äussern.
Es scheint paradox: Die Erfolgsgeschichte der Klubs hat ihren Niedergang eingeläutet. Mit ihren kulturellen Veranstaltungen haben der Klub Zukunft und die Piranha-Bar den «Kreis Cheib» aufgewertet. Und dadurch das Interesse von Grosskonzernen und Immobilienfirmen geweckt.
Das Schicksal der beiden Diskotheken sei ein typisches Beispiel für die Gentrifizierung, findet Alexander Bücheli. Als Mediensprecher vertritt er die Bar- und Clubkommission Zürich. Er sagt: «Der Druck auf das Nachtleben nimmt zu. Wenn es so weitergeht, verstummen die Klubs.»
Verträge würden nicht erneuert, da die Verwaltungen Mietpreise anstrebten, die für Betreiber von Kulturlokalen nicht bezahlbar seien. Als Beispiel nennt Bücheli das X-tra im Limmathaus und fügt an: «Jeder Verlust einer Klub-Location ist kaum zu ersetzen.»
Bei Neubauten würden keine Klubs eingeplant, da Wohnungen oder andere Betriebe wie 24-Stunden-Shops gewinnbringender seien. Als Folge hätten sich viele Betriebe in Zwischennutzungen eingemietet, so wie das «Hive», der «Sektor 11» oder die «Zukunft». Die Bautätigkeit und die Gentrifizierung führten nun aber dazu, dass diese Zwischennutzungen endeten. «Und es gibt kaum mehr Ausweichmöglichkeiten für Tanzlokale», sagt Bücheli.
Bars konkurrieren mit Klubs
Früher nutzten die Klubs Industriezonen, da sich dort niemand gestört fühlte. Heute haben sich diese Zonen grösstenteils in Wohnraum verwandelt. Zudem seien die Hürden für die Neueröffnung eines Klubs enorm gestiegen.
Dabei sei die Nachfrage nach Klubs ungebrochen gross, versichert Bücheli. «Natürlich nutzen die jungen Leute dank Musikboxen auch vermehrt den öffentlichen Raum, um privat zu feiern», sagt er. Doch das allein setze die Klubs nicht unter Druck.
Eine gewisse Konkurrenz bestehe mit Bars, die vermehrt DJ organisierten. Doch letztlich würden diese Veranstaltungen die Attraktivität des nächtlichen Angebotes erhöhen, wovon die Klubs wiederum profitierten.
Die Investitionskosten für eine Bar sind niedriger. Zudem benötigt eine Bar weniger Fläche. Während sich die Zahl der Klubs innert zehn Jahren fast halbiert hat, blieb die Anzahl Bars auf hohem Niveau stabil.
Klubs werden gehasst und geliebt. Alle wollen ein breites Angebot, aber nicht vor der eigenen Haustür. Bücheli sagt: «Bei Bauausschreibungen für Diskotheken hagelt es sofort Einsprachen.» Erst kürzlich haben Anwohnerinnen und Anwohner einen Betrieb beim Lochergut verhindert.
Geplant war ein Klub mit 24-Stunden-Betrieb am Wochenende. «Brüt-Bar» sollte er heissen und 300 Gästen Platz bieten. Die Stadt bewilligte das Vorhaben zwar, doch die Nachbarn gingen auf die Barrikaden. Online starteten sie einen Appell gegen das Vorhaben, der von 1000 Personen unterzeichnet wurde.
Doch damit nicht genug. Die Anwohner organisierten einen Flohmarkt, eine Fundraising-Bar und sammelten Geld für eine Anwältin. Gegen die Baubewilligung reichten sie einen Sammelrekurs ein. Im Herbst 2022 ging das Unternehmen hinter dem Klub in Konkurs und wurde liquidiert. Die Anwohner frohlockten auf ihrer Website: «Der geplante Nachtklub ist Geschichte.»
Die Angst vor der Zukunft
Will Zürich sein Klubleben bewahren und, falls ja, wohin dann mit den Diskotheken? Bücheli sagt: «Finden wir keine Antwort, geht diese Kultur verloren.»
So sieht es auch Franky. Zugleich fragt er sich: «Wohin mit meinem Leben?» Der Türsteher sagt: «Es macht mir Angst, dass ich nicht weiss, was nach der Piranha-Bar kommt. Ich arbeite gern mit Menschen, habe ein gutes Team, einen guten Chef.» Vielleicht eröffne er eine Sicherheitsfirma oder arbeite an einem anderen Ort als Türsteher. «Doch eigentlich möchte ich die Piazza Cella nicht verlassen», sagt er.
Vor ein paar Wochen seien ein paar Polizisten auf einen Kaffee vorbeigekommen. Da habe einer von ihnen gesagt: «Komm doch zu uns.» Darauf angesprochen, ob er zur Polizei ginge, wenn sie ihm ein ernsthaftes Angebot machte, sagt er, ohne zu zögern: «Ja.» Franky muss sich wandeln und wird sich verändern. So wie das Zürcher Nachtleben.