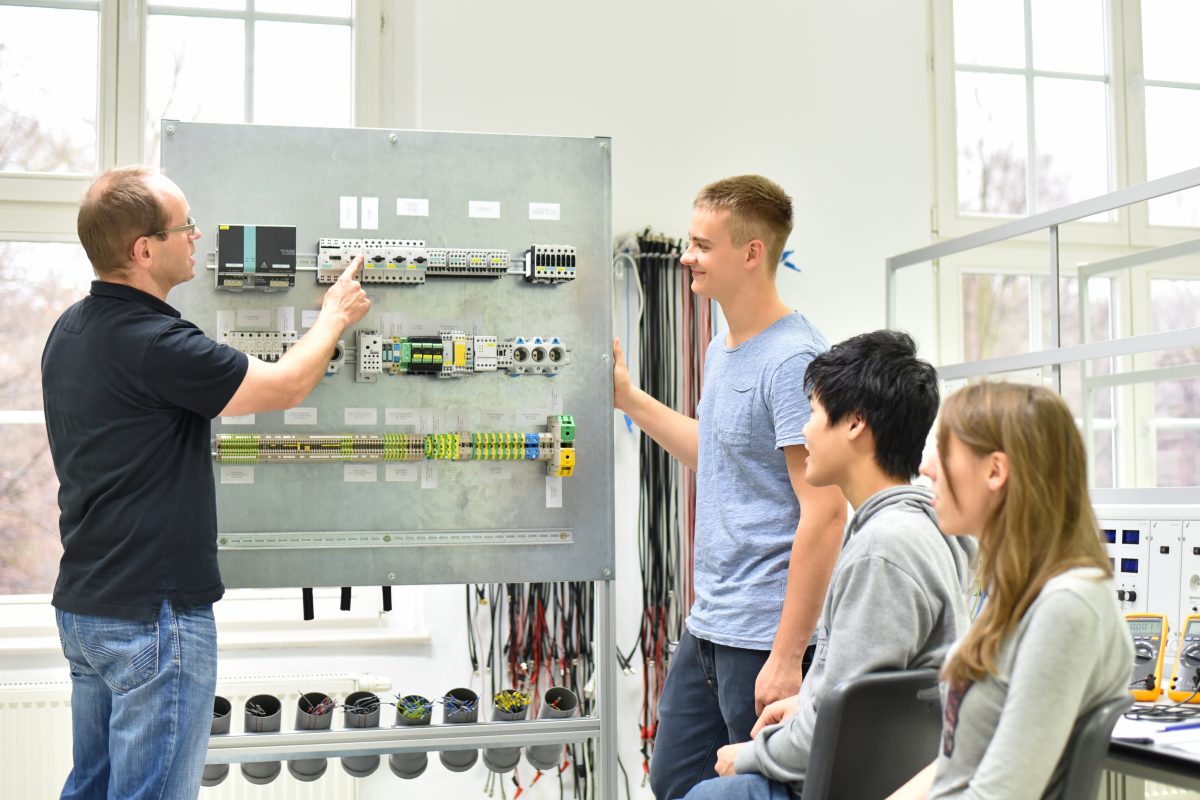Der Staat vergoldet seine Beamten – und befeuert damit den Fachkräftemangel im Privatsektor Der Staat zahlt fürstliche Saläre und lockt mit allerlei Zückerchen. Viele Private können nicht mehr mithalten.
Der Staat zahlt fürstliche Saläre und lockt mit allerlei Zückerchen. Viele Private können nicht mehr mithalten.

Zürichs Stadtverwaltung wünschte auf ihrem Instagram-Kanal noch «ein schönes und hoffentlich sonniges Auffahrts-Wochenende!» und ward nicht mehr gesehen. Denn von Mittwoch bis Montag blieben «die meisten Büros der Stadtverwaltung geschlossen». So eine ausgedehnte Brücke hat man selten gesehen. Aber als Bürger der grössten Stadt der Schweiz muss man wohl froh sein, wenn die Verwaltung am Montag überhaupt wieder aufmacht. So in einer Woche zwischen Auffahrt und Pfingsten gelegen.
Manch Staatsangestelltem geht es prächtig, nicht nur in Zürich. Alle drei Jahre fühlt der Bund seinem Personal den Puls, dieses Frühjahr gab es neue Ergebnisse. Die Bundesverwaltung erhält sehr gute Noten. Beispielsweise wurde die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, schon bisher gut, sogar noch verbessert. «Erfreuliche» 88 Prozent der Befragten würden die Verwaltung als Arbeitgeberin empfehlen.
Die Umfrage bestätigt, was längst kein Geheimnis mehr ist: Wer in Zeiten von Teuerung und sinkenden Reallöhnen beim Staat arbeitet, hat das goldene Los gezogen.
Die Lohnkosten übernimmt der Steuerzahler
So erhalten Beschäftigte beim Bund durchschnittlich 12 Prozent mehr Lohn als in vergleichbaren Stellen in der Privatwirtschaft. Dies zeigt eine Studie der Wirtschaftswissenschafter Marco Portmann und Christoph Schaltegger vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Auch die Kantone und Gemeinden bezahlen ihre Angestellten bei vergleichbarer Qualifikation in der Regel besser als die Privatwirtschaft. Gemäss der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung lag zwischen 2018 und 2020 der durchschnittliche Jahresbruttolohn beim Bund bei 117 176 Franken, in der Privatwirtschaft bei 88 896 Franken. Hinzu kommen deutlich bessere Vorsorgeleistungen.
Der Lohnindex 2023 spricht ebenfalls eine deutliche Sprache. Unter Anrechnung der Teuerung gingen hierzulande in der Gesamtwirtschaft die realen Löhne im Vergleich zum Vorjahr um ein halbes Prozent zurück. In der öffentlichen Verwaltung dagegen stiegen sie um 1,5 Prozent. In keiner anderen Branche wuchsen die Löhne derart.
Auch wenn dem Einzelnen derlei privilegierte Arbeitsbedingungen zu gönnen sind, werden überbezahlte Staatsangestellte zu einem Problem. Der Staat konkurrenziert so die freie Wirtschaft, namentlich kleine und mittlere Unternehmen (KMU) können nicht mehr mithalten. Ihre Löhne sind vom Wettbewerb bestimmt, nur durch mehr Produktivität können sie erhöht werden. Anders die Verwaltung, die ihre Lohnkosten weitgehend auf den Steuerzahler überwälzen kann. Für Unternehmen wird es dadurch schwieriger, freie Stellen zu besetzen. Sie sind demografiebedingt mit einem verschärften Fachkräftemangel konfrontiert. Darunter leidet die Wettbewerbsfähigkeit.
Die Städte wetteifern mit neuen Privilegien
Früher galt: Die öffentliche Verwaltung bietet eine sichere Stelle. Dafür ist man leicht schlechter bezahlt als in der Privatwirtschaft. Wer die Lohnentwicklung der vergangenen Jahre betrachtet, erkennt aber einen gegenteiligen Trend. Ein regelrechter Graben tut sich zwischen Staatsdienst und Privatsektor auf.
Zum Lohn kommen diverse Nebenleistungen und Zückerchen, um die sich die Verwaltungen, gerade jene der Städte, einen regelrechten Wettbewerb liefern. Das jüngste Beispiel kommt aus der Stadt Freiburg, die beschloss, den Vaterschaftsurlaub fürs eigene Personal von sechs auf acht Wochen zu verlängern. Beileibe kein Einzelfall, so offeriert die Stadt Bern zum achtwöchigen Vaterschaftsurlaub sogar noch sechs Wochen bezahlte Elternzeit.
Auch in der Stadt Zürich wird nicht mit Privilegien für das Verwaltungspersonal gegeizt. Jüngst hat die rot-grüne Mehrheit im Parlament einem Pilotversuch für eine 35-Stunden-Woche zugestimmt. Manche Angestellte werden neu vier statt fünf Tage pro Woche arbeiten und trotzdem den vollen Lohn erhalten. Komplett unnötig ist der Mens-Dispens, der ebenfalls eine Mehrheit im Rat fand: Frauen sowie Trans- und nonbinäre Personen sollen sich pro Monat bis zu fünf Tage bezahlt krankschreiben lassen können.
Ab und zu werden Auswüchse gekappt, die in Politik und Verwaltung gediehen sind. Oft braucht es dafür aber die Stimmbevölkerung, wie jüngst in Zürich, wo die Bevölkerung abtretenden Amtsträgern den Abschied nicht mehr vergolden will. Zuvor sorgten Entschädigungen von über 650 000 Franken für den Präsidenten einer Kreisschulbehörde oder 850 000 Franken für eine Stadträtin schweizweit für Aufsehen.
Nicht nur die Spitzenleute werden beim Bund überbezahlt
Als der Bund vor Jahren einen Lohnvergleich mit der Privatwirtschaft erstellen liess, verglich man sich nicht mit KMU, sondern mit Weltkonzernen wie Nestlé, Roche oder Swiss Life. Nur mit guten Salären könnten fähige Leute angestellt werden, ist denn als Rechtfertigung auch stets zu hören. Die Verwaltung überzahlt aber längst nicht nur ihre Spitzenkräfte. So werden gerade die vergleichsweise niedrigen Löhne in den Verwaltungen gegenüber der Privatwirtschaft stärker bevorteilt, wie besagte Studie des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik zeigt. Dabei besteht etwa bei einem normalen Sachbearbeiter-Job kaum eine Notwendigkeit, mit Google und Co. zu konkurrieren.
Als Bürger will man darauf vertrauen können, dass sich Verwaltung und Politik nicht überhöhte Löhne zuschanzen. Zumindest beim Lohnsystem des Bundes ist es zweifelhaft, ob die positiven Kräfte des Wettbewerbs wirklich spielen. Vielmehr gibt es eine quasiautomatische jährliche Lohnerhöhung, die Bundespersonalverordnung macht es möglich. 96 Prozent des Personals arbeiten «gut» oder «sehr gut» und erhalten deshalb Jahr für Jahr mehr Lohn.
In manchen Bereichen konkurrenziert die Verwaltung die Privaten direkt, etwa wenn es darum geht, Hochschulabsolventen anzuwerben. Umfragen unter Studienabgängern zeigen regelmässig, dass der Staatsdienst bei den meisten zuoberst auf der Wunschliste steht. Der Staat verschärft mit seinen Privilegien den Wettbewerb um Talente. Die Überzahlung der Verwaltung dürfte auch nicht dem Willen der Wähler und Steuerzahler entsprechen.
Die Verwaltung wuchs überproportional zur Bevölkerung
Die hohen Löhne sind das eine, die wachsende Zahl der Staatsangestellten das andere. Rund 10 Prozent der Schweizer Gesamtbeschäftigung entfielen 2019 auf die Verwaltungen. Der Wohlstand einer Gesellschaft wird aber vom privaten Sektor erwirtschaftet.